Die Gibberellin-Familie erklärt: Wissenschaftlicher Vergleich zwischen GA₃ und GA₄+₇
- Fernando Chen

- 7. Nov. 2025
- 6 Min. Lesezeit
Im Bereich der Pflanzenwachstumsregulation bildet die Gruppe der Gibberelline (GAs) eine große „Familie“ natürlicher Verbindungen – bislang wurden über 130 verschiedene Gibberelline identifiziert. Sie fungieren als die „Wachstumsdirigenten“ der Pflanzen und steuern zentrale physiologische Prozesse wie Samenkeimung, Sprossstreckung, Blüte und Fruchtbildung.
Interessanterweise begann die Entdeckung dieser Stoffgruppe mit einer rätselhaften Reis-Krankheit, die Landwirte in Japan vor ein Jahrhundert stellte – und führte zu einer der bedeutendsten wissenschaftlichen Entdeckungen in der Pflanzenphysiologie.
Heute konzentrieren wir uns auf die beiden am häufigsten genutzten Vertreter dieser Familie – GA₃ (Gibberellinsäure) und GA₄+₇ (Gibberellinsäuren A₄ und A₇) – um ihre Eigenschaften, wissenschaftlichen Grundlagen und Anwendungsunterschiede zu verstehen.
I. Ursprung: Vom „Verrückten Reissetzling“ zur Entdeckung der Gibberelline
Die Geschichte der Gibberelline begann im Japan des frühen 20. Jahrhunderts. Reisbauern beobachteten, dass einige Pflanzen ungewöhnlich hoch wuchsen, dünne, schwache Halme bildeten und kaum Körner ansetzten. Diese Erscheinung wurde als „Bakanae“ oder „verrückte Setzlingskrankheit“ bezeichnet.
1926 führte der japanische Pflanzenpathologe Eiichi Kurosawa erste systematische Experimente dazu durch. Er mahlte befallene Reishalme, extrahierte den Saft und behandelte damit gesunde Pflanzen – die daraufhin ebenfalls übermäßig wuchsen. Damit bewies er, dass der Erreger eine wachstumsfördernde Substanz produziert, die er „Gibberellin“ nannte – nach dem verursachenden Pilz Gibberella fujikuroi.
In den folgenden Jahrzehnten forschten Wissenschaftler weltweit weiter: 1935 isolierte der Japaner Teijiro Yabuta erstmals den kristallinen Wirkstoff aus der Pilzkultur. In den 1950er Jahren klärten die britischen Forscher Brian Cross und J. MacMillan die Struktur von GA₃ auf; kurz darauf wurden GA₄ und GA₇ in Erbse und Mais entdeckt. Diese drei Verbindungen wurden zu den bekanntesten natürlichen Vertretern der Gibberellin-Familie.
Ab 1958 begann die industrielle Produktion von GA₃ mittels mikrobieller Fermentation; einige Jahre später fand GA₄+₇ breite Anwendung im Obstbau, insbesondere zur Regulierung des Fruchtansatzes.
Wichtig ist: Gibberelline sind keine synthetischen Hormone. Fast alle höheren Pflanzen – von Weizen und Mais bis zu Äpfeln – synthetisieren sie selbst in wachstumsaktiven Geweben wie Wurzelspitzen, Sprossspitzen oder unreifen Samen. Industriell hergestellte GA₃- und GA₄+₇-Produkte sind chemisch identisch mit den natürlichen Formen und werden von Pflanzen effizient erkannt und genutzt.
II. Grundverständnis: Zentrale Eigenschaften von GA₃ und GA₄+₇
Als Hauptmitglieder der Gibberellin-Familie weisen GA₃ und GA₄+₇ sowohl gemeinsame Merkmale als auch deutliche Unterschiede auf. Diese zu verstehen, ist die Grundlage für eine zielgerichtete Anwendung.
2.1 Gemeinsame Eigenschaften – Die „Kernkraft“ der Wachstumsregulation
Chemisch gesehen sind GA₃ und GA₄+₇ tetracyclische Diterpenoide mit dem charakteristischen Gibberellin-Grundgerüst. Diese Struktur verleiht ihnen ähnliche physiologische Funktionen.
Ihr Wirkmechanismus ist nahezu identisch: Beide binden an spezifische Rezeptoren (GID1) in Pflanzenzellen, fördern den Abbau von DELLA-Proteinen, die als Wachstumshemmer wirken, und aktivieren anschließend wachstumsrelevante Gene. Dadurch werden Zellstreckung (durch Auflockerung der Zellwand und Expansion der Vakuolen) und Zellteilung angeregt. Gleichzeitig regulieren sie das Gleichgewicht anderer Hormone wie Abscisinsäure und Auxin.
Bezüglich der Sicherheit gilt: Pflanzenhormone unterscheiden sich grundlegend von tierischen Hormonen. GA₃ und GA₄+₇ können keine menschlichen Rezeptoren aktivieren und besitzen keine biologische Aktivität über Arten hinweg. Nach Aufnahme werden sie im Verdauungssystem zu einfachen organischen Molekülen abgebaut. Bei sachgemäßer Anwendung liegen Rückstände in Lebensmitteln weit unter den gesetzlichen Grenzwerten und stellen kein Risiko für die Lebensmittelsicherheit dar.
In der Herstellung beruhen beide Produkte auf mikrobieller Fermentation mit speziellen Gibberella fujikuroi-Stämmen. In präzise gesteuerten Fermentern werden Parameter wie Temperatur, pH-Wert und Belüftung optimiert. Nach der Fermentation werden die Wirkstoffe extrahiert, gereinigt und zu Emulsionskonzentraten, Wasserlösungen oder löslichen Pulvern formuliert.
2.2 Die Wurzel der Unterschiede – Struktur bestimmt Verhalten
Der entscheidende Unterschied zwischen GA₃ und GA₄+₇ liegt in ihrer Molekularstruktur.
GA₃ hat die Summenformel C₁₉H₂₂O₆ mit einem charakteristischen Lactonring und mehreren Hydroxylgruppen.
GA₄ (C₁₉H₂₄O₅) und GA₇ (C₁₉H₂₂O₅) enthalten weniger Hydroxylgruppen, was ihnen eine etwas höhere Stabilität verleiht.
Diese kleinen strukturellen Unterschiede führen zu abweichender Stabilität, biologischer Aktivität und Anwendungsleistung.
Stabilität: GA₃ ist empfindlicher gegenüber Licht, Wärme und alkalischen Bedingungen; oberhalb von 30 °C oder bei pH > 7,0 zerfällt es rasch, mit einer Wirkungsdauer von etwa 7–10 Tagen. GA₄+₇ zeigt unter diesen Bedingungen eine etwas höhere Beständigkeit und wirkt rund 15–20 Tage lang.
Aktivitätsschwerpunkt: GA₄+₇ ist biologisch aktiver bei Zellteilung und Fruchtentwicklung, während GA₃ stärker auf Zellstreckung wirkt. Diese Unterschiede bestimmen die jeweiligen Einsatzgebiete.
III. Vergleichende Anwendung: GA₃ vs. GA₄+₇ in Kulturpflanzen und Funktionen
Aufgrund ihrer unterschiedlichen Struktur und physiologischen Aktivität besitzen GA₃ und GA₄+₇ klar abgegrenzte Anwendungsfelder – jedes mit spezifischen Vorteilen je nach Kultur und Wachstumsphase.
3.1 Zentrale physiologische Funktionen
Funktion | GA₃ (Gibberellinsäure) | GA₄+₇ (Gibberellinsäuren A₄+A₇) | Hauptursache |
Aufhebung der Samenruhe | ★★★★★ Sehr stark; aktiviert α-Amylase und fördert Keimung schwer keimbarer Samen | ★★★☆☆ Mäßig; wirkt vor allem bei leicht ruhenden Samen | GA₃ stimuliert direkt die α-Amylase-Bildung |
Vegetatives Wachstum | ★★★★★ Deutliche Sprossstreckung und Blattstielverlängerung | ★★★☆☆ Milder, geringes Risiko des Überwachsens | GA₃ stärker auf Zellstreckung, GA₄+₇ mehr auf Zellteilung |
Blüten- und Fruchtansatz | ★★★★☆ Erhöht Fruchtansatz, bei Überdosierung Gefahr von Deformation | ★★★★★ Stabile Fruchtbildung, gleichmäßige Entwicklung | GA₄+₇ wirkt ausgeglichener auf Blüten- und Fruchtorgane |
Fruchtvergrößerung & Qualität | ★★★☆☆ Fördert Größenzuwachs, kann Süße/Härte verringern | ★★★★★ Gleichmäßige Fruchtgröße, bessere Süße, Festigkeit & Färbung | GA₄+₇ unterstützt Zuckerbildung, GA₃ kann Nährstoffverteilung stören |
Stressresistenz | ★★☆☆☆ Schwächer, bei Hitze instabil | ★★★★☆ Verbessert Kälte- und Trockenresistenz | Stabilere Molekülstruktur von GA₄+₇ erhält Aktivität unter Stress |
3.2 Anbaukulturen und Anwendungsszenarien
GA₃ – Für schnelles Wachstumsmanagement:
Blattgemüse: Sellerie, Spinat, Salat – Sprühen in Wachstumsphasen fördert Stiel- und Blattlänge und beschleunigt die Ernte um 5–7 Tage.
Getreidesaatgutbehandlung: Einweichen von Reis-, Weizen- oder Maissamen in GA₃-Lösung vor der Aussaat verbessert die Keimung bei niedrigen Temperaturen und sorgt für gleichmäßige Bestände.
Zierpflanzenförderung: Bei Pfingstrosen oder Tulpen hilft GA₃, die Ruhe zu brechen und frühere, längere Blütenstiele zu erzeugen.
GA₄+₇ – Für Qualitätssteigerung:
Obstbäume: Apfel, Birne, Weinrebe – Sprühen 1–2 Wochen nach der Blüte erhöht den Fruchtansatz, verringert Missbildungen und verbessert Festigkeit und Süße.
Beerenfrüchte: Erdbeeren, Heidelbeeren – Anwendung während Blüte oder Fruchtansatz fördert gleichmäßige Färbung.
Gewächshausgemüse: Tomate, Paprika – Anwendung während der Blüte in kühlen Perioden vermindert Blütenabwurf und sorgt für gleichmäßige Früchte.
3.3 Wichtige Anwendungsparameter
Parameter | GA₃ | GA₄+₇ | Empfehlung |
Wirksame Konzentration | 20–100 mg/L (kulturabhängig) | 10–30 mg/L | GA₃ exakt dosieren; zu hohe Konzentrationen führen zu Überstreckung. Zu viel GA₄+₇ kann Blätter kräuseln. |
Optimale Temperatur | 20–25 °C (über 30 °C instabil) | 15–30 °C (breiteres Fenster) | GA₃ vorzugsweise abends sprühen, GA₄+₇ tagsüber (nicht in praller Sonne). |
Mischverträglichkeit | Nur mit neutralen oder schwach sauren Mitteln | Mit den meisten neutralen oder leicht alkalischen Mitteln | GA₃ nicht mit stark alkalischen Produkten mischen; GA₄+₇ vorab im Kleinversuch testen. |
Wirkungsdauer | 7–10 Tage | 15–20 Tage | GA₃ für kurzfristige Wachstumsförderung, GA₄+₇ für längerfristige Fruchtregulierung. |
IV. Wissenschaftliche Auswahl: Das richtige Gibberellin für den richtigen Zweck
GA₃ und GA₄+₇ sind keine Konkurrenten, sondern komplementäre Werkzeuge. Die Wahl hängt von Kultur, Wachstumsphase und Ziel ab.
4.1 Auswahlprinzipien
Nach Ziel: Für schnelle Streckung oder Keimung → GA₃; für Fruchtqualität und Stabilität → GA₄+₇.
Nach Kultur: Blattgemüse, Saatgut und Zierpflanzen → GA₃; Obst, Beeren, Gewächshauskulturen → GA₄+₇.
Nach Umwelt: In heißen, hellen oder alkalischen Böden wirkt GA₄+₇ stabiler; unter gemäßigten Bedingungen ist GA₃ kosteneffizienter.
Nach Wachstumsphase: Vegetative Phase (Keimung, Sprossstreckung) → GA₃; Reproduktive Phase (Blüte, Fruchtansatz, Fruchtwachstum) → GA₄+₇.
4.2 Häufige Fehlannahmen
„GA₄+₇ ist immer besser.“ – In Blattgemüsen wie Sellerie oder Spinat bleibt GA₃ unersetzlich für Längenwachstum.
„Mehr Konzentration bringt mehr Wirkung.“ – Überdosierung verursacht Schäden: GA₃ kann Überstreckung und Deformationen, GA₄+₇ Blattkräuselung oder Fruchtfall hervorrufen.
„Gibberelline ersetzen Düngung.“ – Sie regulieren hormonelle Signale, liefern aber keine Nährstoffe. Fehlende Nährstoffversorgung führt zu schwachem Wachstum trotz Anwendung.
„Verwechslung von Wirkstoff und Formulierung.“ – Die Sprühkonzentration muss anhand des tatsächlichen Wirkstoffgehalts (z. B. 10 % WP) berechnet werden.
V. Branchentrends: Innovation und Standardisierung in der Gibberellinproduktion
Mit dem Trend zu präziser und hochwertiger Landwirtschaft entwickeln sich GA₃ und GA₄+₇ technisch weiter.
Produktinnovation: GA₃-Forschung konzentriert sich auf verbesserte Stabilität – etwa durch Mikroverkapselung zur Wirkungsverlängerung und Reduktion der Sprühhäufigkeit. GA₄+₇ wird zunehmend mit Auxinen (z. B. 2,4-D) oder Cytokininen (z. B. 6-BA) kombiniert, um „Fruchtansatz + Fruchtwachstum + Qualitätssteigerung“ in einem Schritt zu vereinen.
Grüne Produktion: Moderne Prozesse nutzen genetisch optimierte Gibberella fujikuroi-Stämme mit 15–25 % höherer Ausbeute und umweltfreundlichere Extraktionsmittel, wodurch Lösungsmittelverbrauch und Umweltbelastung reduziert werden.
Diese Fortschritte kennzeichnen den Wandel der Gibberellinprodukte hin zu höherer Effizienz, Nachhaltigkeit und Präzision.
VI. Fazit: Den richtigen „Dirigenten“ für intelligentes Wachstum wählen
Von der rätselhaften Reis-Krankheit bis zum modernen Präzisionswerkzeug in der Landwirtschaft – die Gibberelline stehen sinnbildlich für das Prinzip, „Lösungen aus der Natur zu entdecken“.
GA₃ mit seiner starken Streckungswirkung ist ein Schlüsselinstrument zur Ertragssteigerung bei Blattgemüse und zur Förderung der Keimung. GA₄+₇ hingegen überzeugt durch stabile Leistung und Qualitätsverbesserung bei Obst- und Sonderkulturen.
Der Schlüssel zum erfolgreichen Einsatz liegt darin, die Bedürfnisse der Pflanze zu verstehen – das richtige Mittel, den richtigen Zeitpunkt und die passenden Bedingungen zu wählen.
Mit fortschreitender Forschung und Standardisierung werden GA₃ und GA₄+₇ künftig eine noch wichtigere Rolle bei der Effizienzsteigerung, Ernährungssicherung und Qualitätsverbesserung in der modernen Landwirtschaft spielen.



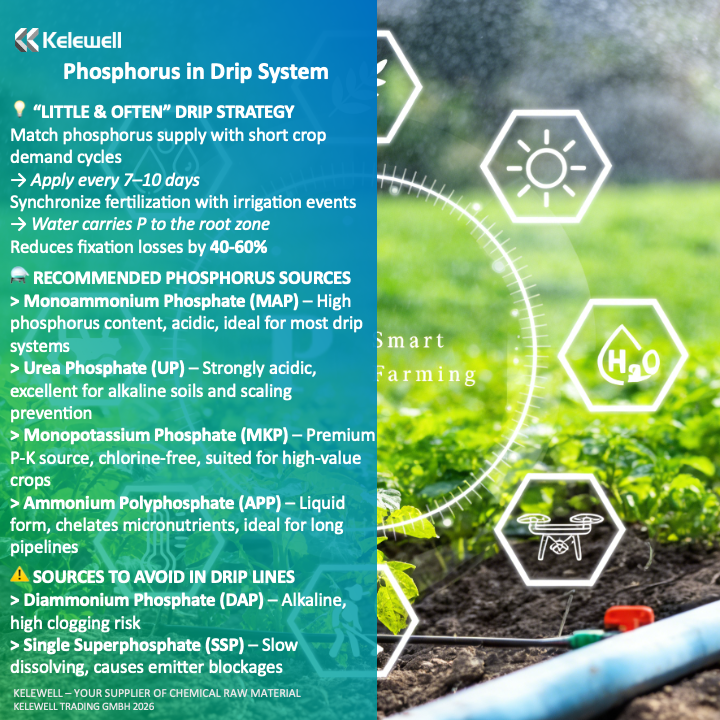
Kommentare