Steigerung der Traubenqualität und -erträge mit MKP: Der Schlüssel zu süßeren und stärkeren Ernten
- Fernando Chen

- 14. Mai 2025
- 10 Min. Lesezeit
Trauben, bekannt als die „sonnenverwöhnte Frucht“, die die Menschheit seit Jahrtausenden begleitet, sind ein geschätzter Genuss – von den Altären des Dionysos im antiken Griechenland bis zu den Obst- und Gemüseregalen moderner Städte – und verschmelzen Süße und Aroma zu einem festen Bestandteil des menschlichen Geschmacksgedächtnisses.
Als eine der weltweit am häufigsten angebauten und ertragreichsten Obstbäume bezaubern Trauben nicht nur mit ihren vielfältigen Aromen – von der saftigen Fülle der Kyoho-Sorten bis zum süßen Rosenduft des Shine Muscat –, sondern auch mit dem unermüdlichen Streben der Menschheit nach Perfektion: kernlose Sorten, die durch Hybridisierung entstehen, phenolische Verbindungen, die durch tägliche Temperaturschwankungen verstärkt werden, und unterschiedliche, vom Klima geprägte Terroirs. Doch erst die wissenschaftliche Abstimmung von Boden und Düngung offenbart die wahre Formel für hochwertige, ertragreiche Trauben.
Um Trauben anzubauen, die den Anforderungen an Süße und stabile Erträge entsprechen, müssen Winzer nicht nur die grundlegenden Wachstumsanforderungen der Kulturpflanze erfüllen, sondern auch die zentrale Herausforderung der Nährstoffversorgung bewältigen. Phosphor und Kalium – oft als das „goldene Duo“ des Traubenwachstums bezeichnet – spielen während des gesamten Wachstumszyklus, von der Wurzelentwicklung über die Blüten- und Fruchtbildung bis hin zur Reifung, eine unersetzliche Rolle.
Dieser Artikel zeichnet den Weg vom Austrieb bis zur Ernte nach, konzentriert sich auf diese beiden Elemente und untersucht, wie Monokaliumphosphat (MKP) die Traubenproduktion mit präziser Nährstoffversorgung versorgt.
I. Grundlegende Umweltanforderungen für das Weinwachstum
Hochwertiger und ertragreicher Weinanbau erfordert die präzise Steuerung von fünf zentralen Umweltfaktoren: Licht, Temperatur, Wasser, Boden und Nährstoffe. Nachfolgend finden Sie eine Analyse ihrer jeweiligen Rolle und der idealen Bedingungen.
1. Licht: Die zentrale Energiequelle der Photosynthese
Wie alle grünen Pflanzen sind auch Weinreben auf Sonnenlicht angewiesen, um Photosynthese zu betreiben – dabei werden Kohlendioxid und Wasser in Glukose und Sauerstoff umgewandelt.
Zentrale Funktionen:
Sonnenlicht treibt die Photosynthese an und beeinflusst direkt die Zuckeranreicherung sowie die Fruchtreife.
Ausreichende Lichtverhältnisse sorgen für dicke, dunkelgrüne Blätter, eine hohe Photosyntheserate, kräftiges Wachstum, gute Blütenknospenbildung und einen hohen Zuckergehalt in den Beeren sowie stabile Erträge.
Optimale Bedingungen:
Jahres-Sonnenscheindauer: ≥ 1.500 Stunden
Während der Vegetationsperiode: täglich mindestens 6 Sonnenstunden
Folgen von Lichtungleichgewicht:
Lichtmangel (z. B. bei Regen oder starker Bewölkung): führt zu schwachen Trieben (Internodienlänge >15 cm), dünnen Blättern, geringer Stresstoleranz, Blüten- und Fruchtfall, schlechter Ausfärbung der Beeren und niedrigem Zuckergehalt.
Übermäßige Lichteinstrahlung (z. B. bei starker direkter Sonneneinstrahlung): verursacht Sonnenbrand (braune Flecken auf der Beerenhaut) und senkt die Effizienz der Photosynthese.
2. Temperatur: Der rhythmische Regulator des Wachstums
Weinreben sind wärmeliebende Pflanzen und stellen je nach Wachstumsstadium und Jahreszeit unterschiedliche Anforderungen an die Temperatur.
Temperaturgrenzen und Anforderungen je Wachstumsphase:
Austrieb: ≥ 10 °C notwendig für den Wachstumsbeginn; Temperaturen unter 0 °C können Knospen schädigen.
Triebwachstum & Blüte: Optimal bei 20–30 °C; unter 15 °C oder bei neblig-regnerischem Wetter kommt es zu Blütenstörungen und schlechter Bestäubung – die Fruchtfallrate kann um 30 % steigen.
Reifephase: Ideal bei 20–32 °C; unter 20 °C entstehen schwache Ausfärbung und niedriger Zuckergehalt; über 32 °C erhöht sich das Risiko von Sonnenbrand und verminderter Fruchtschalenfestigkeit.
Geografische und mikroklimatische Einflüsse:
Breitengrad: Die wichtigsten Weinbauregionen liegen zwischen dem 30. und 50. Breitengrad (nördlich und südlich), um die Temperaturbedürfnisse während Dormanz und Vegetation zu erfüllen.
Mikroklimatische Anpassungen: Höhenlagen sorgen für Abkühlung in warmen Gebieten; Meeresströmungen mildern kalte Regionen.
Lokale Maßnahmen: Weißfolie auf dem Boden erhöht die Bodentemperatur; die Ausrichtung des Weinbergs kann die Sonneneinstrahlung verlängern.
3. Wasser: Die Lebensader des Stoffwechsels im gesamten Wachstumszyklus
Wasser ist für die Photosynthese, Transpiration und Fruchtreife der Weinrebe unverzichtbar. Die Wurzeln nehmen Wasser auf und transportieren es zu den Blättern. Je höher die Temperatur, desto schneller verdunstet das Wasser über die Blätter – der Wasserbedarf steigt entsprechend.
Nach vollständiger Laubentwicklung kann eine reduzierte Wasserversorgung dazu beitragen, die Nährstoffverlagerung in die Früchte zu fördern – dies führt zu volleren, geschmackvolleren Beeren.
Wasserbedarf je Wachstumsphase:
Austrieb: Ausreichende Bodenfeuchtigkeit sorgt für frühen und gleichmäßigen Austrieb sowie schnelles Triebwachstum.
Blüte: Zu viel Regen fördert übermäßiges Triebwachstum und Blütenabwurf; Trockenheit beeinträchtigt die Bestäubung.
Beerenwachstum: Höchster Wasserbedarf zur Unterstützung der Zellvergrößerung.
Verfärbung bis Reife: Moderates Wassermanagement verbessert Zucker-Säure-Verhältnis und Süße; zu viel Regen fördert vegetatives Wachstum und senkt den Zuckergehalt.
Ernte: Starker Niederschlag kann zu Beerenplatzen und Geschmacksverwässerung führen.
Gefahren eines Wasserungleichgewichts:
Anhaltende Trockenheit: Stoppt die Photosynthese, hemmt das vegetative Wachstum, verursacht starken Blüten- und Fruchtfall und mindert Ertrag sowie Qualität erheblich.
Hohe Luftfeuchtigkeit: Erhöht das Krankheitsrisiko und kann im Extremfall zum Absterben der Wurzeln führen.
4. Boden: Das fundamentale Medium für die Wurzelentwicklung
Ideale Bodeneigenschaften:
Textur: Sandiger Lehmboden mit einer Porosität von > 40 % – gewährleistet sowohl Belüftung als auch Feuchtigkeits- und Nährstoffspeicherung; fördert das Tiefenwachstum der Wurzeln (Hauptwurzeln bis zu 1,5 m möglich).
pH-Wert: Neutral bis schwach sauer (6,0–7,5).
In alkalischen Böden (pH > 8,0) wird die Aufnahme von Eisen und Zink stark beeinträchtigt.
Ungeeignete Böden:
Schwere Tonböden: Schlechte Drainage, erhöhte Gefahr von Sauerstoffmangel und Wurzelfäule (Risiko von Wurzelfäule steigt um 25 %).
Salz-alkalische Böden: Giftige Natriumionen; zur Bodenverbesserung sind 50 kg Gips + 30 kg Huminsäure pro Hektar erforderlich.
Sumpfböden / Sandige Böden:
Sumpfböden fördern Wurzelfäule.
Sandböden verursachen starke Nährstoffauswaschung (Düngemittelwirksamkeit sinkt um 40 %).
5. Nährstoffe: Die synergetische Wirkung der drei Hauptelemente
Stickstoff (N), Phosphor (P) und Kalium (K) sind die drei unverzichtbaren Nährstoffe für das Wachstum von Weinreben. Ein Mangel an einem dieser Elemente kann zu erheblichen Ertragsverlusten und einer spürbaren Verschlechterung der Fruchtqualität führen.
Element | Zentrale Funktionen | Mangelerscheinungen | Auswirkungen auf Ertrag & Qualität |
Stickstoff (N) | Fördert Triebwachstum und Chlorophyllbildung (dunkelgrüne Blätter) | Vergilbung junger Blätter, Wachstumsstillstand | 15–20 % Ertragsverlust; Photosyntheseleistung um 30 % reduziert |
Phosphor (P) | Wurzelentwicklung, Blütenorganbildung, Energietransfer | Dunkelgrüne ältere Blätter, kleine Blütenstände, geringe Fruchtansatzrate | Fruchtansatzrate sinkt um 20 %; schlechte Fruchtausbildung |
Kalium (K) | Zuckertransport, Stresstoleranz (Trockenheit/Krankheiten) | Blattspitzenverbrennungen, weiche Beeren, geringer Zuckergehalt | Zuckergehalt um 2–3 °Brix reduziert; Aufplatzrate der Beeren steigt um 25 % |
II. Techniken der Rebpflanzung: Zentrale Maßnahmen von der Vermehrung bis zur Erziehung
Die Art und Weise, wie Reben gepflanzt werden, hat direkten Einfluss auf ihre Wuchskraft, den Ertrag und die Fruchtqualität. Zu den entscheidenden Schritten gehören die Vermehrungsmethode, die Wahl des Erziehungssystems (Rankhilfe) sowie die Technik der Pflanzung. Der folgende Abschnitt bietet eine praxisnahe Anleitung für Weinbergsbetreiber weltweit.
1. Vermehrungsmethoden: Stecklinge vs. Veredelung – Anpassung an verschiedene Klimazonen
Weinreben werden hauptsächlich über Stecklinge oder durch Veredelung vermehrt – beide Methoden haben ihre Vor- und Nachteile:
Stecklingsvermehrung:
Methode: Auswahl gesunder, einjähriger Triebe, Zuschnitt auf 15–20 cm Länge, Einsetzen in ein feuchtes Saatbeet (20–25 °C, 80 % Luftfeuchtigkeit).
Vorteile: Geringe Kosten, schnelle Jungpflanzenentwicklung (Fruchtansatz bereits im 2. Jahr möglich); gut geeignet für warme Klimazonen (z. B. Mittelmeerregion).
Nachteile: Flaches Wurzelsystem (< 50 cm Tiefe), geringe Toleranz gegenüber Kälte sowie Schädlingen und Krankheiten.
Veredelung (Pfropfung):
Methode: Edelsorte auf widerstandsfähige Unterlage pfropfen; Heilungsphase ca. 2–3 Wochen.
Vorteile: Tiefreichendes Wurzelsystem (bis zu 1,5 m), hohe Frosttoleranz (bis –20 °C) und Resistenz gegen Wurzelreblaus; ideal für kalte Regionen.
Nachteile: Längerer Jungpflanzenzyklus (Vollertrag ab dem 3. Jahr), benötigt fachkundiges Personal.
2. Erziehungssysteme: Optimale Lichtverteilung für gesunde Reben
Ein gut konzipiertes Rankhilfesystem verbessert die Lichtdurchdringung und reduziert das Krankheitsrisiko. Gängige Systeme sind:
„Y“-Erziehungssystem:
Struktur: Reihenabstand 3–3,5 m, Pflanzenabstand 1,5–2 m, Rankhöhe 1,8–2,0 m.
Vorteile: Geschichteter Laubaufbau sorgt für gleichmäßige Lichtverteilung, geeignet für mechanischen Schnitt; weit verbreitet im Tafeltraubenanbau (z. B. Kyoho, Summer Black).
Pflanzdichte: 110–150 Reben pro Acre (≈ 270–370 Reben/ha).
„V“-Erziehungssystem:
Struktur: Zwei aufgerichtete Arme im Winkel von 70°–90°, Reihenabstand 2,5–3 m, Pflanzenabstand 1–1,2 m.
Vorteile: Dichte Bepflanzung mit hohem Ertragspotenzial, besonders geeignet für Premiumsorten wie Shine Muscat; gute Belüftung erforderlich zur Krankheitsvermeidung.
Pflanzdichte: 200–220 Reben pro Acre (≈ 500–540 Reben/ha).
3. Pflanztechnik: Grundlage für ein starkes Wurzelsystem
Optimale Pflanzzeit:
Kühle Regionen (Norden): Frühjahrspflanzung
Warme Regionen (Süden): Herbstpflanzung
Graben-Vorbereitung:
Tiefe: 50–60 cm
Breite: 80–100 cm
Aufbrechen verdichteter Bodenschichten, um tiefes Wurzelwachstum zu fördern.
Schichtweise Düngung:
Unterste Schicht: 10 cm Stroh zur Verbesserung der Belüftung
Mittlere Schicht: 3–5 t/ha gut verrotteter organischer Dünger + 10–15 kg/ha MKP
(Monokaliumphosphat) zur Förderung des Wurzelwachstums
Oberste Schicht: Mit Oberboden abdecken; Veredelungsstelle mindestens 5 cm über Bodenniveau platzieren (zum Schutz vor Staunässe)
Pflege nach der Pflanzung:
Angießen zur Wurzelverankerung (inkl. 0,1 % MKP), anschließendes Abdecken mit Folie zur Wärmespeicherung
Im ersten Jahr 1–2 kräftige neue Triebe belassen; bei 80 cm Länge entspitzen, um ein ausgewogenes Wachstum zu fördern
Zusammenfassung der Pflanzstrategie:
Stecklinge eignen sich für warme Regionen mit kurzer Produktionszeit.
Veredelte Pflanzen bieten in kälteren oder krankheitsanfälligen Gebieten mehr Sicherheit durch stärkere Widerstandsfähigkeit.
Das gewählte Erziehungssystem sollte Lichtverteilung und Pflegemanagement ausbalancieren:
„Y“-System für großflächige Anlagen
„V“-System für dichte, ertragsorientierte Bepflanzung
Die Pflanzung sollte stets auf ein starkes Wurzelumfeld abzielen – die schichtweise Düngung ist dabei der Schlüssel für eine vitale, langlebige Rebe.
III. Phosphor und Kalium: Die „Kernformel“ für hochwertige und ertragreiche Trauben
Die Grundlage für herausragende Traubenqualität liegt in der gezielten Aufnahme von Phosphor und Kalium durch die Wurzeln. Für Erzeuger weltweit, die süßere, farbintensivere und stabilere Ernten anstreben, liegt die Antwort in der Synergie von Phosphor (P) und Kalium (K).
1. Phosphor (P): Der „Wachstumsmotor“ – von der Wurzel bis zum Fruchtansatz
Zentrale Funktionen:
Wurzelentwicklung: Fördert die Zellteilung an den Wurzelspitzen, erhöht die Anzahl der Wurzeln und vergrößert die Aufnahmefläche – besonders wichtig in den ersten drei Monaten nach der Pflanzung.
Blütenentwicklung: Beteiligt an der Verlängerung des Pollenschlauchs; Phosphormangel senkt die Pollenqualität und den Fruchtansatz, was zu „Blüten ohne Frucht“ führt.
Energietransfer: Wesentlicher Bestandteil von ATP (Adenosintriphosphat), das Photosynthese, Zuckertransport und Zellteilung antreibt – besonders stark nachgefragt während des Triebwachstums.
Mangelerscheinungen:
Blätter: Ältere Blätter dunkelgrün und stumpf; Blattstiele rötlich-violett; kleine und dünne Blätter.
Blüten & Früchte: Kurze Blütenstände, starker Blütenabwurf, gestoppte Entwicklung junger Beeren („Stichfrucht“).
Wurzeln: Kurze, dicke Hauptwurzeln; wenig Seitenwurzeln; geringe Aufnahmefähigkeit, schwache Pflanzenvitalität.
Kritische Entwicklungsphasen:
Austrieb: Unterstützt Wurzelwachstum und Energiereserven für das folgende Wachstum.
Blüte: Sichert die Entwicklung der Blütenorgane und verbessert den Fruchtansatz.
Beerenwachstum: Fördert die Zellteilung und das Längenwachstum der Beeren.
2. Kalium (K): Der „letzte Schalter“ für Fruchtqualität
Zentrale Funktionen:
Photosynthese: Aktiviert Chlorophyll-Synthase, steigert Blattleistung – besonders wichtig in der Reifephase zur Zuckereinlagerung.
Zuckertransport: Aktiviert Saccharosetransporter, die Zucker aus den Blättern in die Früchte verlagern – fördert den Zuckergehalt.
Stresstoleranz: Verdickt die Wachsschicht der Beerenhaut, reduziert Sonnenbrand und Aufplatzen; erhöht Frostresistenz der Wurzeln.
Mangelerscheinungen:
Blätter: Verbrannte Blattränder, eingerollte Blätter, verminderte Photosynthese.
Früchte: Weiche Beeren, frühes Abfallen, ungleichmäßige Färbung, schlechtes Zucker-Säure-Verhältnis.
Triebe: Unzureichende Verholzung, schwache Knospen, gestörte Blütenknospenbildung im Folgejahr.
Kritische Entwicklungsphasen:
Beerenwachstum: Fördert Zellvergrößerung in den Beeren, erhöht das Einzelbeerengewicht.
Verfärbung: Aktiviert Anthocyan-Synthese, verbessert die gleichmäßige Ausfärbung.
Reife: Stärkt die Beerenbindung an den Stiel, reduziert Fruchtfall vor der Ernte und verbessert die Lagerfähigkeit.
3. Phosphor-Kalium-Synergie: Das „Goldene Duo“, bei dem 1 + 1 > 2
Aufnahmecharakteristik:
Gleichzeitiger Bedarf: Reben erreichen den höchsten P- und K-Bedarf während der Beerenwachstumsphase – dieser Zeitraum macht über 50 % der Gesamtaufnahme aus. Das P₂O₅:K₂O-Verhältnis von 1,5:1 im MKP entspricht dieser Anforderung ideal.
Synergieeffekt: Phosphor verbessert den Kaliumtransport und dessen Nutzung, Kalium wiederum fördert die Aktivität von Phosphor in den Zellen – dadurch werden negative Antagonismen bei Einzelnährstoffgaben vermieden.
4. Warum Monokaliumphosphat (MKP)?
Traditionelle Düngung | Herausforderungen | Vorteile von MKP |
Einzelne Phosphordüngung (z. B. Superphosphat) | Bindet sich leicht an Calcium/Magnesium im Boden, nur 15–20 % Wirkungsgrad | Vollständig wasserlöslich, rückstandsfrei, Phosphorausnutzung steigt auf 35–40 % |
Einzelne Kaliumdüngung (z. B. Kaliumchlorid) | Chlorid reichert sich an und schädigt Wurzeln – Reben sind chloridempfindlich | Chloridfreie Formel, geeignet für alle Bodentypen – auch für salzhaltige Böden |
P und K getrennt ausgebracht | Höhere Aufwandmengen, mehr Arbeitskosten | P & K in einer Gabe – reduziert Düngefrequenz um ca. 30 % |
Weitere Vorteile
Löslichkeit: Löst sich bei 20 °C bis zu 22 g/100 ml – ideal für Tropfbewässerung und Fertigation ohne Verstopfung.
Sicherheit: pH-Wert von 4,5–5,5; kompatibel mit den meisten Pflanzenschutzmitteln und Blattdüngern; kein Risiko einer Bodenversauerung.
IV. Nährstoff- und Wassermanagement: Präzise Vollzyklus-Düngung mit MKP
Reben sind mehrjährige Pflanzen, die Jahr für Jahr wachsen und Frucht tragen – dabei entziehen sie dem Boden große Mengen an Nährstoffen. Um dauerhaft ein kräftiges Wachstum sowie hohe Qualität und stabile Erträge zu gewährleisten, muss die Düngung wissenschaftlich fundiert und zeitlich abgestimmt erfolgen. Wer den „Nährstoff-Biorhythmus“ der Rebe versteht und MKP (Monokaliumphosphat) in den entscheidenden Wachstumsphasen gezielt einsetzt, hat einen klaren Qualitätsschlüssel in der Hand.
Nachfolgend finden Sie einen Düngeplan basierend auf den phänologischen Entwicklungsstadien der Rebe:
1. Grunddüngung: Herbstliche „Energiespeicherung“ im Boden
Ziel: Regeneration des Rebstocks, Nährstoffspeicherung und Förderung der Winterknospenentwicklung.
Anwendungsempfehlung:
✔ 3–5 Tonnen pro Acre (≈ 7,5–12,5 t/ha) gut verrotteter organischer Dünger + 15–20 kg MKP pro Acre (≈ 37–50 kg/ha), tief einarbeiten (30–40 cm graben).
✔ Wirkung von MKP: Phosphor regt das Wurzelwachstum an; Kalium stärkt die Kälteresistenz der Wurzeln.
Internationales Beispiel: In den Weinbergen der Region Bordeaux (Frankreich) macht MKP 60 % der Phosphor-Kalium-Komponente der Herbstdüngung aus – die Gleichmäßigkeit des Austriebs im Folgejahr steigt um 25 %.
2. Kopfdüngung: Präzise Nährstoffzufuhr im Takt des Wachstums
Wachstumsphase | Düngeziel | MKP-Anwendung | Zusätze | Erwartete Wirkung |
Austrieb | Förderung neuer Triebe und kräftiger Blütenanlagen | Tropfbewässerung: 10–15 kg/Acre + Blattdüngung: 0,2 % | Huminsäure: 5 kg/Acre | Austriebs-Gleichmäßigkeit ↑ 20 %, Anzahl der Blütenstände ↑ 15 % |
Beerenwachstum | Fruchtvergrößerung, Rissvermeidung, Zellteilung | Flächenbewässerung: 15–20 kg/Acre + Blattdüngung: 0,3 % (7-tägig) | Kalzium-Polyol: 10 kg/Acre (alle 3 Tage) | Einzelbeerengröße ↑ 12 %, Rissrate ↓ 30 % |
Farbwechsel | Zuckeranreicherung, Farbausprägung, Alterungsprotektion | Tropfbewässerung: 20–25 kg/Acre + Blattdüngung: 0,5 % | Aminosäure-Blattdünger: 8 kg/Acre | Zuckergehalt ↑ 2–3 °Brix, gleichmäßige Färbung ↑ 40 % |
Anwendungshinweise:
✓ Tropfbewässerung mit Konzentration ≤ 0,2 %, um Salzansammlung zu vermeiden (EC-Wert < 1,5 mS/cm).
✓ Blattdüngung am besten abends, Fokus auf Blattunterseite (höhere Spaltöffnungsdichte verbessert Aufnahme um 30 %).
3. Blattdüngung als Notfallmaßnahme bei Stresssituationen
Spätfrost im Frühjahr: Bei Temperaturen unter 0 °C während des Austriebs sofort mit 0,2 % MKP + 0,1 % Brassinolid sprühen – stabilisiert Zellmembranen und beschleunigt Erholung.
Anhaltender Regen: Nach längerer Regenperiode 0,3 % MKP + 0,1 % Kupfersulfat sprühen – Kalium erhöht Enzymaktivität zur Krankheitsabwehr, reduziert Befall mit Falschem Mehltau.
4. Fehlervermeidung: Drei Goldene Regeln
Konzentration beachten: Blattdüngung maximal 0,5 %; bei Hitzeperioden auf 0,1–0,2 % reduzieren, um Blattverbrennungen zu vermeiden.
Mischbarkeit prüfen: Nicht mit stark alkalischen Produkten (z. B. Bordeauxbrühe) mischen – 72 Stunden Abstand einhalten, um Ausfällungen von Phosphat zu vermeiden.
Bodenmonitoring: Bei MKP-Einsatz über mehr als drei Jahre: jährliche pH-Messung. Bei pH < 6,0 empfiehlt sich die Ausbringung von Branntkalk (50 kg/Acre ≈ 125 kg/ha) zur pH-Korrektur.
Hauptvorteile unseres MKP-Produkts
Monokaliumphosphat (MKP) ist ein hochreines, vollständig wasserlösliches Düngemittel, das Phosphor (P) und Kalium (K) in einem optimalen Verhältnis bereitstellt – exakt abgestimmt auf die Bedürfnisse von Reben über alle Entwicklungsphasen hinweg.
✔ P₂O₅ ≥ 52 %, K₂O ≥ 34 % – ideale Nährstoffbalance für Weinreben
✔ Vollständig wasserlöslich – geeignet für Tropfbewässerung & Blattdüngung
✔ Chlorid- und natriumfrei – sicher für chloridempfindliche Kulturen wie Reben
✔ Niedriger Salzindex & pH-Wert 4,5–5,5 – bodenschonend & mischbar mit den meisten Agrochemikalien
✔ Schnelle Löslichkeit – verstopft keine Bewässerungsleitungen (22 g/100 ml bei 20 °C)
Globale Qualität, lokal unterstützt
Unser MKP wird unter strenger Qualitätskontrolle produziert und entspricht internationalen Standards.Ob im Tafeltraubenanbau oder im Weinbau – MKP ermöglicht eine präzise Nährstoffsteuerung, die sich in gleichbleibend hoher Qualität und Ertrag auszahlt.
📦 Maßgeschneiderte Verpackung, technische Dokumentation und Logistiklösungen – für Europa, Lateinamerika oder Asien.
📩 Jetzt anfragen: info@kelewell.de für Spezifikationen und Analysezertifikat (COA).
Fazit: Vom erfahrungsbasierten Anbau zur wissenschaftlich fundierten Düngung
Der Traubenanbau besteht letztlich darin, präzise auf die natürlichen Wachstumsrhythmen zu reagieren. Das ausgewogene Zusammenspiel von Phosphor und Kalium bestimmt die innere Qualität der Frucht. Der gezielte und wissenschaftlich fundierte Einsatz von MKP eröffnet eine universelle Formel für hohe Erträge und außergewöhnliche Qualität.
Ob im Tafeltraubenanbau Kaliforniens oder in den Weinbergen des Burgunds – die nährstoffgerechte Düngung entlang der phänologischen Entwicklungsphasen hilft jeder Traube, ihr volles Potenzial zu entfalten.
In der nächsten Ausgabe werfen wir einen genaueren Blick auf die weiteren Eigenschaften von MKP, um Ihnen bei der Auswahl des optimalen Düngemittels für Ihren Weinberg zu helfen.

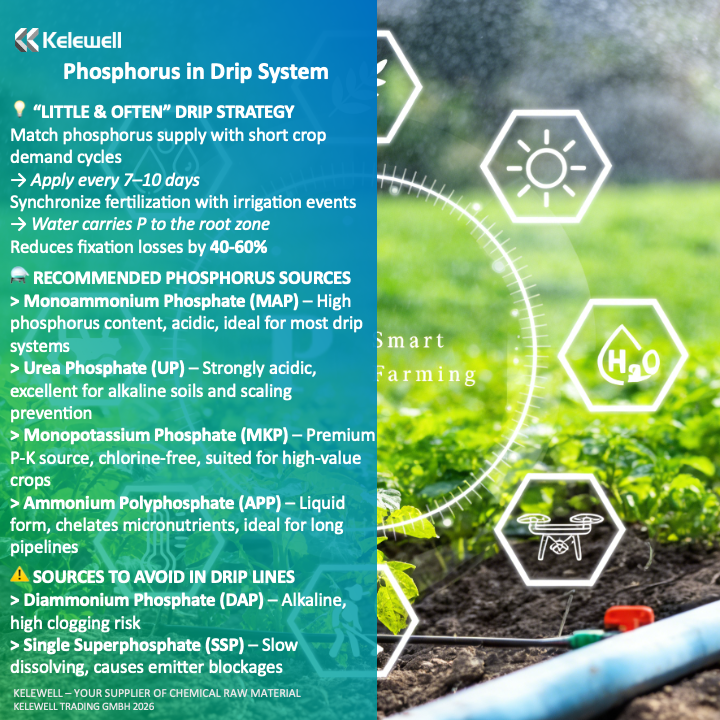


Kommentare