Phosphogips: Vom Deponie-Dilemma mit 600 Millionen Tonnen zur nachhaltigen Ressourcennutzung
- Camille W.

- 23. Juli 2025
- 2 Min. Lesezeit
In unserem am 16. Juli veröffentlichten Fachartikel wurde die Wertschöpfungskette der Phosphatchemie umfassend erläutert. Hier geht's zum Beitrag: https://www.kelewell.de/en/post/the-phosphate-chemical-an-integrated-value-chain
Darin wurde erklärt, dass Phosphorsäure ein grundlegender chemischer Rohstoff ist. Die aktuellen Produktionsverfahren sind das Nassverfahren und das Thermoverfahren. Beim Nassverfahren wird Phosphatgestein mit starker Mineralsäure (meist Schwefelsäure) aufgeschlossen. Das Thermoverfahren hingegen reduziert hochreines Apatitgestein zu gelbem Phosphor, der anschließend oxidiert und hydratisiert wird.
Heute werden rund 90 % der globalen Phosphorsäureproduktion durch das Nassverfahren abgedeckt. Die Hauptreaktion lautet:
Ca5(PO4)3F + 5H2SO4 + 10H2O → 5CaSO4·2H2O + 3H3PO4 + HF↑
Dabei fällt in großen Mengen Phosphogips (CaSO4·2H2O) als Nebenprodukt an.
Was ist Phosphogips?
Phosphogips (PG) ist der feste Rückstand, der bei der Phosphorsäureproduktion durch Schwefelsäurebehandlung von Phosphatgestein entsteht. Für jede Tonne Phosphorsäure entstehen 4–6 t PG. Das Material liegt meist als grauweißes, gelbliches oder leicht grünliches Pulver vor, ist sauer (pH 1,9–5,3), hat eine Dichte von 0,733–0,88 g/cm³, 10–30 % freies Wasser und besteht aus 40–200 μm großen Partikeln.
Phosphogips enthält komplexe Verunreinigungen (z. B. organische/inorganische Phosphate, Fluoride, Kalium, Natrium), die seine Verwendung einschränken. Deshalb sind vor der Weiterverwertung geeignete Reinigungs- und Modifikationsmaßnahmen erforderlich.
Verunreinigungen & Umweltprobleme
Unlöslich: Quarz, Apatit, schwerlösliches P2O5, Fluoride, Phosphate von Al/Mg
Löslich: Wasserlösliches P2O5, Fluoride, Sulfate
Organisch: z. B. Glykolester, Methoxypentan, Isothiocyanmethan
Spurenelemente: As, Cu, Zn, Fe, Mn, Pb, Cd, Hg – meist unbedenklich
Verunreinigungen wie freies H3PO4 oder lösliche Fluoride wirken sich negativ auf Bauanwendungen aus (z. B. Hydratationsverzögerung, Festigkeitsverlust). In China werden jährlich ~80 Mio. t PG produziert, mit über 600 Mio. t Lagerbestand – ein gravierendes ökologisches, sicherheitstechnisches und wirtschaftliches Problem.
Entfernungsmethoden für Verunreinigungen:
Physikalisch: Waschen, Flotation, Mahlen, Sieben, Altern (Waschen effektiv, aber abwasserintensiv)
Thermisch: Kalzinierung entfernt Phosphatverbindungen (einfache Technik, kein CaSO4·2H2O nachher)
Chemisch: z. B. CaO-Zugabe zur Neutralisation von löslichem P/F, pH-Anpassung
Nutzung weltweit:
USA: 98 % deponiert (viel Fläche, Gipsvorkommen)
Japan: ~100 % genutzt – 60 % Bau, 30 % Zement, Rest Nahrung/Medizin
Deutschland: 95 % genutzt – v. a. Zementverzögerer
Hauptanwendungen:
Bau: Innenbaustoffe (Platten, Blöcke, Spachtel, nur für trockene Räume)
Straßenbau: stabiler, kostengünstiger Unterbau
Bergbau/Ökorestaurierung: Verfüllung von Hohlräumen und Tagebau
Landwirtschaft: Bodenverbesserung, pH-Regulierung, Ca/S/P-Versorgung
Chemie: Calciumsulfat-Whisker, Ammoniumsulfat, Kaliumsulfat – hohe Reinheit, Mehrwert
Fazit
Der weltweite Bedarf an Phosphatdüngern bleibt hoch – und damit auch die Herausforderung durch PG. Eine nachhaltige Zukunft braucht:
Kostengünstige Entsorgungstechnologien im industriellen Maßstab
Interdisziplinäre Nutzungskonzepte
Politische Fördermaßnahmen
Lasst uns gemeinsam an einer grünen Kreislaufchemie arbeiten!




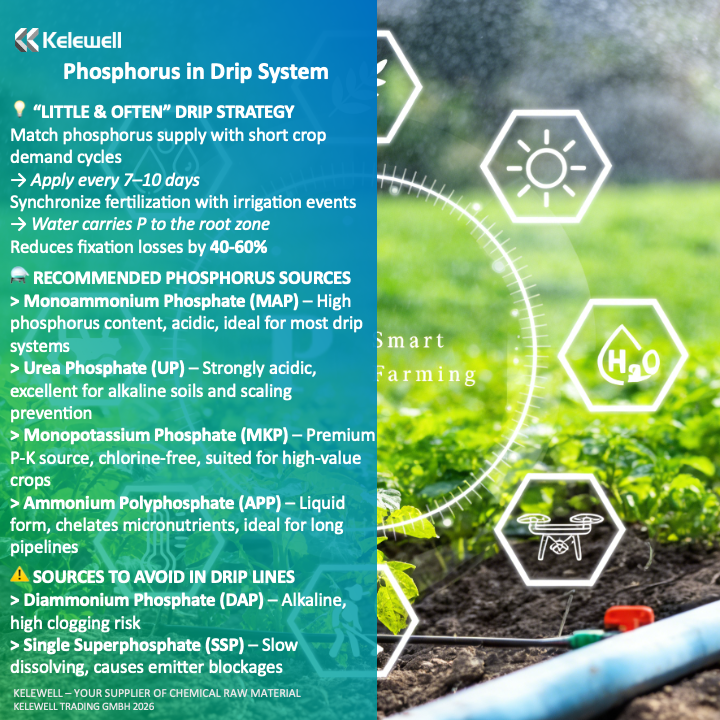

Kommentare