Kupfersulfat – Eine populärwissenschaftliche Einführung: Von blauen Kristallen zum „Wächter“ der Landwirtschaft – Die vielseitigen Werte von Kupferverbindungen
- Fernando Chen

- 5. Sept. 2025
- 9 Min. Lesezeit
Wenn man an „blaue Kristalle“ denkt, erinnert man sich sofort an das „Blaue Vitriol“ im Labor oder an die „Bordeaux-Brühe“, die in der Landwirtschaft zur Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten eingesetzt wird. Diese vertrauten Szenarien verdeutlichen den vielfältigen Wert von Kupfersulfat (CuSO₄).
Als ein häufig vorkommendes Kupfersalz dient es in seiner wasserfreien Form als Trockenmittel und in kristalliner Form als Fungizid. Darüber hinaus wurde es dank der Erfindung der Bordeaux-Brühe zu einem unverzichtbaren „Werkzeug zur Krankheitsbekämpfung“ in der Agrargeschichte.
Dieser Artikel beleuchtet Kupfersulfat aus verschiedenen Perspektiven – seine chemische Natur, Herstellungsprozesse und Hydratformen – und zeichnet zugleich die legendäre Geschichte der Bordeaux-Brühe nach, um ein umfassendes Verständnis dieser bemerkenswerten blauen Verbindung zu vermitteln.
I. Grundwissen über Kupfersulfat: Chemische Natur und physikalische Eigenschaften
Um die „vielseitigen Anwendungen“ von Kupfersulfat zu verstehen, muss man zunächst seine „chemische Identität“ betrachten. Kupfersulfat ist ein Salz, das aus Kupferionen (Cu²⁺) und Sulfationen (SO₄²⁻) besteht, mit der chemischen Formel CuSO₄. Seine wesentlichen Eigenschaften unterscheiden sich deutlich danach, ob es Wasser enthält oder nicht.
(1) Zentrale chemische Eigenschaften
Wertigkeit und Stabilität: Im Kupfersulfat liegt Kupfer in der Oxidationsstufe +2 vor (stabile Wertigkeit). Daher ist Kupfersulfat relativ stabil und zersetzt sich bei Raumtemperatur nicht leicht. Bei hohen Temperaturen (über 650 °C) zerfällt es jedoch in Kupferoxid (CuO), Schwefeldioxid (SO₂) und andere Stoffe und verliert damit seine ursprünglichen Funktionen.
Löslichkeit und Acidität: Kupfersulfat ist leicht in Wasser löslich (Löslichkeit bei 20 °C ca. 20,7 g/100 mL). Seine wässrige Lösung ist schwach sauer (pH ≈ 3,8–4,5). Diese Eigenschaft ermöglicht es, mit alkalischen Substanzen Niederschläge zu bilden (z. B. bei der Herstellung von Bordeaux-Brühe) und Kupferionen in Lösung freizusetzen, die fungizid wirken.
(2) Physikalische Unterschiede zwischen zwei Hauptformen
Die „morphologische Vielfalt“ von Kupfersulfat ist der Schlüssel zu seinen breiten Anwendungsmöglichkeiten. Die beiden häufigsten Formen sind wasserfreies Kupfersulfat und Kupfersulfat-Pentahydrat, die sich in Aussehen und Eigenschaften stark unterscheiden:
Form | Erscheinungsmerkmale | Dichte (20 °C) | Hygroskopizität / Dehydrationseigenschaften | Zentrales Erkennungsmerkmal |
Wasserfreies CuSO₄ | Weißes bis grauweißes Pulver, geruchlos | 3,603 g/cm³ | Stark hygroskopisch, färbt sich bei Wasserkontakt schnell blau | Farbänderung bei Hydratation (weiß → blau) |
CuSO₄·5H₂O (Pentahydrat) | Blaue Kristalle (orthorhombisch), geruchlos | 2,284 g/cm³ | Bei Raumtemperatur stabil, verliert beim Erhitzen leicht Kristallwasser | Natürliche blaue Farbe, bekannt als „Blaues Vitriol“ oder „Chalkanthit“ |
II. Herstellungsprozess von Kupfersulfat: Von den Rohstoffen zu zwei unterschiedlichen Formen
Die industrielle Herstellung von Kupfersulfat folgt dem Grundprinzip „Kupferquelle oxidieren + Schwefelsäure lösen“. Je nach eingesetzten Rohstoffen gibt es zwei Hauptverfahren. Das Endprodukt kann durch Dehydration / Hydratation entweder in wasserfreier oder kristalliner Form vorliegen.
(1) Hauptverfahren: Zwei Kernrouten
1. Oxidation–Säurelösung von Kupferschrott (industrieller Standard)
Dies ist die wirtschaftlichste Methode, bei der Kupferschrott oder Kupferschlacke als Rohstoff dient. Die Schritte sind wie folgt:
Oxidationsvorbehandlung: Kupferschrott wird in einen Flammofen eingebracht und bei 600–700 °C in Anwesenheit von Luft oxidiert, wodurch Kupferoxid (CuO) entsteht. Wenn Verunreinigungen wie Eisen oder Zink vorhanden sind, können diese bei hohen Temperaturen entfernt werden, da Eisenoxide Schlacke bilden und sich abtrennen.
Auflösen in Schwefelsäure: Nach dem Abkühlen wird das Kupferoxid mit verdünnter Schwefelsäure (30–40 %) bei 80–90 °C unter Rühren umgesetzt, wodurch Kupfersulfatlösung entsteht:
CuO + H₂SO₄ → CuSO₄ + H₂O
Reinigung und Kristallisation: Unlösliche Verunreinigungen werden abfiltriert. Das Filtrat wird in einen Verdampfungskristallisator überführt, bei 60–70 °C konzentriert und anschließend auf 20–25 °C abgekühlt, wobei blaue Kristalle von Kupfersulfat-Pentahydrat (CuSO₄·5H₂O) ausfallen. Für die wasserfreie Form wird das Pentahydrat weiter auf über 250 °C erhitzt, wodurch das gesamte Kristallwasser entfernt wird und ein weißes Pulver entsteht.
2. Rückgewinnung aus Nebenprodukten der Elektrolytkupferproduktion (für Hochreinheitsbedarf)
Dieses Verfahren wird zur Herstellung von Kupfersulfat in Elektronik- und Pharmaqualität mit einer Reinheit von ≥ 99,99 % verwendet:
Kupferhaltige Elektrolyte aus der Elektrolytkupferproduktion werden mit Ionenaustauscherharzen behandelt, um Schwermetallverunreinigungen wie Eisen, Nickel und Blei zu entfernen. Anschließend erfolgt die Verdampfung und Kristallisation, um hochreines Kupfersulfat-Pentahydrat zu gewinnen.
Vorteile: Sehr hohe Reinheit und geringer Verunreinigungsgehalt, wodurch es sich für Pharmazeutika, Elektronik und die Galvanotechnik eignet, wo strenge Reinheitsanforderungen bestehen. Allerdings liegen die Kosten um 30–50 % höher als beim Schrottkupferverfahren.
(2) Hydratations–Dehydratations-Zyklus: Zusammenhang zwischen Formen und Anwendungen
Die Umwandlung von Kupfersulfat-Hydraten ist ein reversibler Prozess. Bei unterschiedlichen Temperaturen gehen jeweils verschiedene Mengen an Kristallwasser verloren, was zu unterschiedlichen Formen und Anwendungen führt, wie in der folgenden Tabelle dargestellt:
Hydrat-Typ | Chemische Formel | Bildungsbedingungen | Erscheinung / Farbe | Hauptanwendung |
Kupfersulfat-Pentahydrat | CuSO₄·5H₂O | Kristallisation aus wässriger Lösung bei Raumtemperatur | Blaue Kristalle | Landwirtschaftliches Fungizid, Futtermittelzusatz, Rohstoff für Galvanik |
Kupfersulfat-Trihydrat | CuSO₄·3H₂O | Erhitzen von CuSO₄·5H₂O auf ca. 102 °C | Blaugrüne Kristalle | Geringe Stabilität, schwer bei Raumtemperatur haltbar; meist Übergangsprodukt beim Erhitzen |
Kupfersulfat-Monohydrat | CuSO₄·H₂O | Weiteres Erhitzen auf ca. 113 °C | Weißes Pulver (leicht bläulich) | Industrielles Trockenmittel (weniger wirksam als wasserfreies CuSO₄) |
Wasserfreies Kupfersulfat | CuSO₄ | Stufenweise Dehydration, vollständig oberhalb von ~250 °C | Weißes Pulver | Feuchtigkeitsindikator (färbt sich bei Hydratation blau), Katalysator in der organischen Synthese |
Zentrale Eigenschaften:
Die Hygroskopizität von wasserfreiem Kupfersulfat macht es zu einem weit verbreiteten Feuchtigkeitsindikator in Labor und Industrie. Beispielsweise kann durch Zugabe einer kleinen Menge wasserfreien CuSO₄ geprüft werden, ob Alkohol oder Ether Wasser enthält – färbt es sich blau, ist Feuchtigkeit vorhanden. Im Gegensatz dazu macht die Stabilität von Kupfersulfat-Pentahydrat diese Form zum „Standard“ in Landwirtschaft und Galvanotechnik, da es bei Raumtemperatur nicht leicht Wasser verliert und daher bequem gelagert und verwendet werden kann.
III. Die Erfindung der Bordeaux-Brühe: Kupfersulfat und die „Revolution“ in der Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten
Wenn man über die Anwendungen von Kupfersulfat spricht, darf man das wohl klassischste Fungizid in der Agrargeschichte nicht außer Acht lassen – die Bordeaux-Brühe. Ihre Erfindung war nicht das Ergebnis gezielter Forschung, sondern eine zufällige Entdeckung, die aus einer Rebenkrankheitskrise hervorging und sowohl Zufall als auch Scharfsinn vereinte.
(1) Die Rebenkrise des 19. Jahrhunderts: Die Geburt der Bordeaux-Brühe
Im Jahr 1882 wurde die Weinregion Bordeaux in Frankreich – ein weltweit berühmtes Weinbaugebiet – von einem schweren Ausbruch des Falschen Mehltaus an Reben heimgesucht. Diese Pilzkrankheit verursachte gelbe Flecken auf den Blättern und ließ die Früchte verfaulen, was zu Ertragseinbußen von über 50 % in jenem Jahr und zu verheerenden wirtschaftlichen Schäden für die Winzer führte. Damals experimentierten Wissenschaftler mit verschiedenen Methoden (wie Schwefelbegasung und Kalkwasserspritzung), doch keine konnte die Ausbreitung der Krankheit wirksam eindämmen.
(2) Millardets „zufällige Entdeckung“: Von der „Abschreckung“ zur „Krankheitsbekämpfung“
Pierre Millardet, Professor für Botanik an der Universität Bordeaux, beobachtete, dass Reben entlang öffentlicher Straßen – bei denen die Winzer eine „besondere Behandlung“ angewandt hatten – kaum oder gar nicht infiziert waren.
Der Grund: Die Winzer besprühten die Reben in Straßennähe mit einer Mischung aus Kupfersulfatlösung (blau) und Kalkwasser (weiß), um Passanten vom Traubenstehlen abzuhalten. Diese Mischung erzeugte eine trübe himmelblaue Schicht, die optisch unattraktiv war (und so den Diebstahl verhinderte) und zudem einen stechenden Geruch hatte. Unerwartet schützte sie die Reben aber auch gegen den Falschen Mehltau.
Millardet erkannte, dass diese Mischung vermutlich fungizide Eigenschaften besaß. Er führte Laborexperimente durch und stellte fest:
Die optimale Rezeptur war 1 Teil Kupfersulfat + 1 Teil Branntkalk + 100 Teile Wasser, die den Falschen Mehltau wirksam kontrollierte und nur minimale Blattschäden verursachte.
Wirkungsweise: Kupferionen (Cu²⁺) wurden langsam freigesetzt, durchdrangen die Zellwände der Pilze und zerstörten deren Enzymsysteme, wodurch die Vermehrung gehemmt wurde. Gleichzeitig verlängerte das alkalische Milieu des Kalks die Freisetzungszeit der Kupferionen und damit die Schutzwirkung.
Im Jahr 1885 veröffentlichte Millardet offiziell seine Ergebnisse und benannte die Mischung als „Bordeaux-Brühe“. Sie verbreitete sich rasch in den Weinbergen Frankreichs und Europas, kontrollierte nicht nur den Falschen Mehltau, sondern erwies sich auch als wirksam gegen andere Krankheiten wie Apfelkrebs und Kartoffelfäule. Damit wurde sie zum meistverwendeten Fungizid ihrer Zeit.
(3) Das „Geheimnis der Langlebigkeit“: Die einzigartigen Vorteile von Kupfersulfat
Die Bordeaux-Brühe ist seit mehr als 140 Jahren im Einsatz – dank der besonderen Eigenschaften des Kupfersulfats:
Breitband-Fungizidwirkung: Wirksam gegen Pilze (Falscher Mehltau, Echte Mehltaupilze) und Bakterien (Zitruskrebs), einsetzbar bei über 200 Kulturen, darunter Trauben, Äpfel, Tomaten und Kartoffeln.
Geringes Resistenzrisiko: Kupferionen zerstören die grundlegenden Enzymsysteme von Mikroorganismen, wodurch diese kaum in der Lage sind, durch Mutationen Resistenzen zu entwickeln – ein klarer Vorteil gegenüber vielen modernen Fungiziden.
Geringe Kosten und einfache Herstellung: Kupfersulfat und Kalk sind preiswert und leicht erhältlich. Landwirte können sie ohne spezielle Geräte in einfachen Verhältnissen mischen, was die Bordeaux-Brühe besonders für den großflächigen Einsatz geeignet macht.
⚠️ Vorsichtsmaßnahmen:
Trotz ihrer Vorteile hat die Bordeaux-Brühe auch Grenzen. Sie ist ein protektives Fungizid – sie muss vor dem Befall aufgetragen werden, um eine Schutzschicht zu bilden. Ihre alkalische Natur bedeutet außerdem, dass sie nicht mit sauren Pestiziden (z. B. Trifloxystrobin) gemischt werden darf, da die Säure die Freisetzung von Kupferionen beschleunigt, was die Phytotoxizität erhöht und die Wirksamkeit verringert.
Darüber hinaus sollte das Mischungsverhältnis je nach Kultur und Krankheit angepasst werden. Ein übermäßiger Einsatz kann zur Kupferanreicherung im Boden führen, die das Wurzelwachstum beeinträchtigt. Daher sollte die Anwendung auf höchstens drei Behandlungen pro Jahr begrenzt werden.
IV. Die vielfältigen Anwendungen von Kupfersulfat: Mehr als nur ein „Allrounder“ in der Landwirtschaft
Über die Verwendung in der Bordeaux-Brühe hinaus spielt Kupfersulfat in seinen unterschiedlichen Formen auch in Industrie, Medizin und Labor eine bedeutende Rolle und findet Anwendung in vielen Bereichen des täglichen Lebens.
(1) Landwirtschaftliche Anwendungen: Von der Krankheitsbekämpfung bis zur Nährstoffergänzung
Fungizid: Die meisten Pilze können bereits bei sehr niedrigen Konzentrationen von Kupfersulfat abgetötet werden. Neben der Bordeaux-Brühe kann Kupfersulfat-Pentahydrat auch verdünnt (1:1000-Lösung) versprüht werden, um Zitruskrebs und die Frühfäule der Tomate zu bekämpfen. Es kann auch zur Reissaatbeizung eingesetzt werden (0,1 %ige Lösung, 24 Stunden Einweichzeit), um das Keimlingssterben zu verhindern. Darüber hinaus kann Kupfersulfat zur Bekämpfung von Escherichia coli eingesetzt werden. Als Algizid wirkt es, indem Kupferionen die Zellwände der Algen durchdringen und das Magnesium im Chlorophyll ersetzen, wodurch die Photosynthese blockiert wird und die Algen absterben.
Futtermittelzusatz: Kupfer ist ein essentielles Spurenelement für das Wachstum von Tieren (es fördert die Hämoglobinsynthese und stärkt das Immunsystem). Durch die Zugabe von 0,02–0,05 % Kupfersulfat-Pentahydrat zum Futter (unter strenger Beachtung der nationalen Vorschriften) können „Kupfermangel-Anämien“ bei Schweinen und Geflügel verhindert und Wachstumsleistung sowie Überlebensrate verbessert werden.
(2) Industrielle Anwendungen: Ein „Kernrohstoff“ für Galvanik und Katalyse
Galvanikindustrie: Kupfersulfat-Pentahydrat ist das wichtigste Elektrolyt beim „Kupfergalvanisieren“. In der galvanischen Badlösung gelöst und mit elektrischem Strom beaufschlagt, lagern sich Kupferionen auf der Oberfläche von Metallteilen (z. B. Eisennägeln oder Zinklegierungen) ab und bilden eine gleichmäßige Kupferschicht, die Rostschutz und eine ansprechende Optik bietet (z. B. kupferbeschichtete Beschläge).
Beschichtungsindustrie: Verwendung bei der Herstellung von Kupferoleat, das als toxische Komponente in Antifouling-Farben für Schiffsrümpfe dient.
Farbstoffindustrie: Einsatz bei der Herstellung von kupferhaltigen Monoazofarbstoffen wie Reaktivbrillantblau, Reaktivviolett oder Phthalocyaninblau als Kupferkomplexbildner.
Wasseraufbereitung: Wasserfreies Kupfersulfat kann industriellem Umlaufwasser (0,5–1 mg/L) zugesetzt werden, um Algen zu kontrollieren. Kupferionen hemmen die Chlorophyllsynthese der Algen und verhindern so die Verstopfung von Leitungen. Außerdem reagieren sie mit Sulfiden im Wasser und bilden Kupfersulfid-Niederschläge, die unangenehme Gerüche beseitigen.
Organische Synthese: Wasserfreies Kupfersulfat wird als Katalysator eingesetzt, um Veresterungsreaktionen zu beschleunigen (z. B. die Synthese von Essigsäureethylester).
(3) Medizin und Labor: Präzise Nachweise und unterstützende Behandlung
Medizinische Anwendungen: Niedrig konzentrierte Kupfersulfatlösungen (0,5–1 %) wurden historisch zur unterstützenden Behandlung von Hautpilzinfektionen (z. B. Fußpilz) eingesetzt, da Kupferionen das Pilzwachstum hemmen. Aufgrund seiner Toxizität darf Kupfersulfat jedoch niemals eingenommen oder auf verletzter Haut angewendet werden, und in der modernen Medizin wurde es weitgehend durch sicherere Antimykotika ersetzt.
Laboranwendungen: Wasserfreies Kupfersulfat ist ein Standard-Feuchtigkeitsindikator. Beispielsweise werden Gase durch ein Trocknungsrohr mit wasserfreiem Kupfersulfat geleitet; färbt sich das Pulver blau, ist Feuchtigkeit vorhanden. Darüber hinaus wird es zur Herstellung von Fehling’scher Lösung (zum Nachweis reduzierender Zucker) sowie im Biuret-Test für Proteine verwendet, bei dem Kupfer mit Proteinen einen violetten Komplex bildet. Damit ist es ein häufig genutztes Reagenz in biochemischen Laboratorien.
V. Sicherheit und Lagerung von Kupfersulfat: Vorsicht vor Toxizität und wissenschaftlich fundierte Anwendung
Obwohl Kupfersulfat vielfältige Anwendungen hat, handelt es sich um ein Schwermetallsalz. Es enthält Kupferionen (eine übermäßige Aufnahme kann zu Kupfervergiftung führen), schmeckt sauer mit leichter Bitterkeit und ist toxisch. Bei versehentlicher Einnahme ist sofortige Behandlung erforderlich – eiweißreiche Nahrungsmittel wie Milch, Eiweiß oder Rindfleisch sollten verabreicht werden, oder es wird Calcium-Dinatrium-EDTA als Antidot eingesetzt. Daher sind sichere Handhabung und Lagerung unerlässlich:
Arbeitsschutz: Beim Ansetzen von Bordeaux-Brühe oder Kupfersulfatlösungen sind Gummihandschuhe und Schutzbrillen zu tragen. Hautkontakt ist zu vermeiden, da er Trockenheit oder Abschuppung verursachen kann. Gelangt die Lösung versehentlich ins Auge, ist dieses 15 Minuten lang gründlich mit viel klarem Wasser zu spülen und anschließend ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Lagerungsanforderungen: Kupfersulfat-Pentahydrat sollte in einem trockenen, kühlen Raum luftdicht verschlossen aufbewahrt werden, um Feuchtigkeit zu vermeiden (es ist zwar nicht stark hygroskopisch, kann aber bei Feuchtigkeit verklumpen). Wasserfreies Kupfersulfat muss absolut luftdicht gelagert werden, um keine Feuchtigkeit aus der Luft aufzunehmen und dadurch seine Wirksamkeit zu verlieren. Beide Formen sind von Lebensmitteln und Kindern fernzuhalten, die Verpackung muss deutlich mit „Giftige Substanz“ gekennzeichnet sein.
Umweltsicherheit: Nach der landwirtschaftlichen Anwendung darf überschüssige Kupfersulfatlösung nicht direkt in Flüsse oder Böden eingeleitet werden. Die Hauptgefahr geht von den dissoziierten Kupferionen (Cu²⁺) aus – als Schwermetallionen können sie in der Natur nicht abgebaut werden und neigen dazu, sich über die Kette Wasser/Boden → Organismen → Nahrungskette anzureichern. Dies birgt langfristige, vielschichtige Risiken für Ökosysteme und die menschliche Gesundheit. Restlösungen müssen neutralisiert werden (durch Zugabe von Kalkwasser zur Bildung von Kupferhydroxid-Niederschlägen), bevor sie entsorgt werden, um eine Kupferionen-Belastung von Boden und Wasser zu vermeiden.
VI. Fazit: Kupfersulfat – Von blauen Kristallen zum „Modellverbindung“ mit vielseitigem Wert
Von einem Feuchtigkeitsindikator im Labor, über einen Schutz vor Pflanzenkrankheiten in der Landwirtschaft bis hin zu einem zentralen Rohstoff in der industriellen Galvanotechnik – Kupfersulfat hat sich dank seiner vielfältigen Formen und breiten Anwendungsmöglichkeiten zu einer wahren
„Modellverbindung“ entwickelt, die Chemie und Alltag miteinander verbindet.
Die Erfindung der Bordeaux-Brühe verdeutlicht zudem, dass wissenschaftliche Durchbrüche oft aus der aufmerksamen Beobachtung zufälliger Phänomene entstehen – eine Rebenkrise führte zur Entstehung eines klassischen Fungizids und verankerte den Wert des Kupfersulfats dauerhaft in der Agrargeschichte.
Heute, mit dem wachsenden Fokus auf Umweltschutz, verschieben sich die Anwendungen von Kupfersulfat in Richtung präziser Nutzung – etwa durch kontrollierte Dosierungen zur Verringerung der Bodenanreicherung und die Entwicklung weniger toxischer Kupferformulierungen. Dennoch bleibt es eine unverzichtbare Verbindung in Landwirtschaft und Industrie.
Das Verständnis der Eigenschaften und Anwendungen von Kupfersulfat ermöglicht uns nicht nur eine sicherere und effektivere Nutzung, sondern lässt uns auch die enorme Kraft chemischer Substanzen bei der Verbesserung des Lebens und der Förderung des industriellen Fortschritts erkennen.
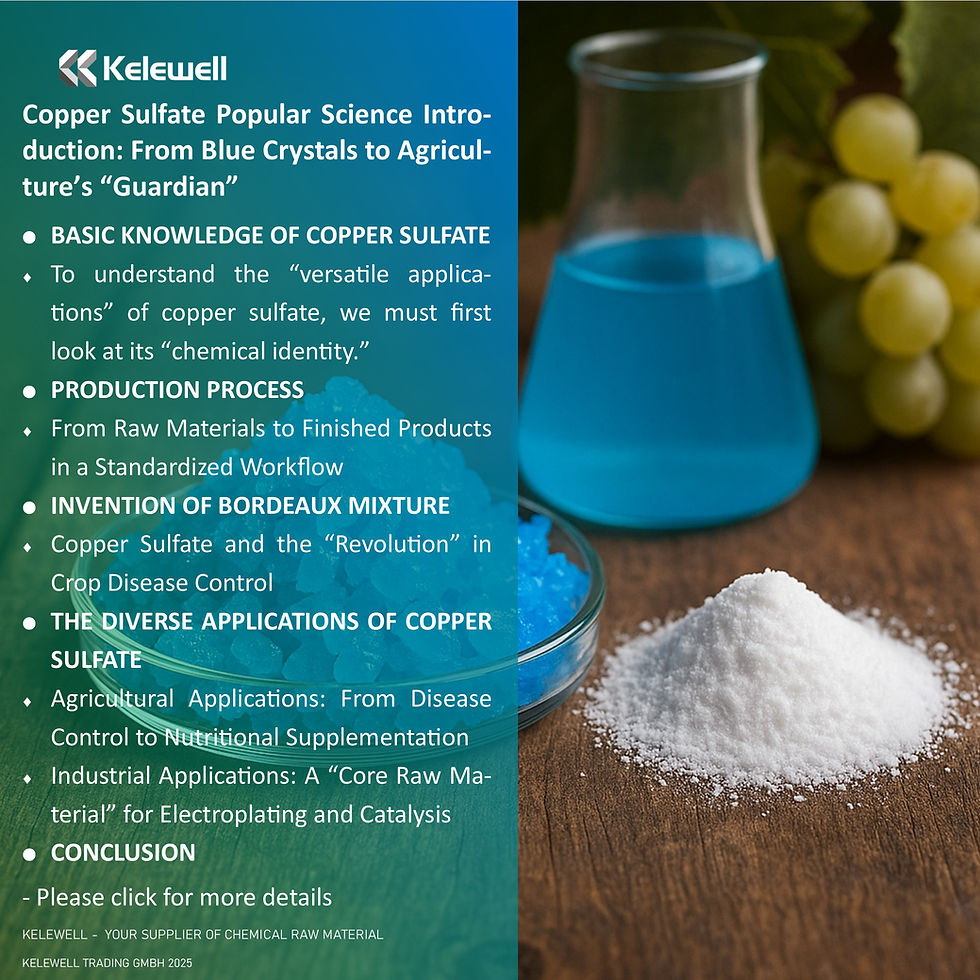
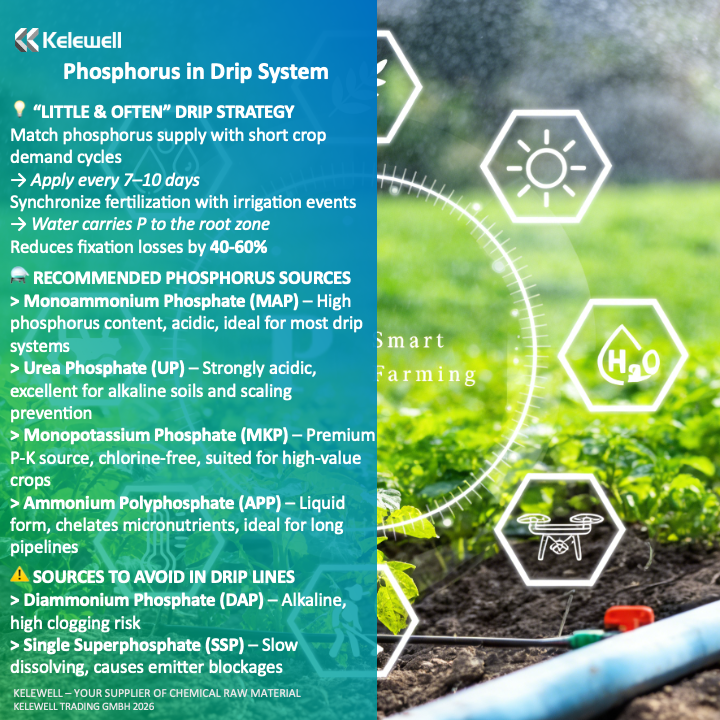


Kommentare