Kaliumcarbonat: Ein multisektoraler Schlüsselrohstoff für Landwirtschaft, Lebensmittel und Industrie
- Camille W.

- 10. Sept. 2025
- 3 Min. Lesezeit
Grundinformationen
Chemische Formel: K₂CO₃
Molekulargewicht: 138,206
CAS-Nummer: 584-08-7
EINECS-Nummer: 209-529-3
Schmelzpunkt: 891 °C
Löslichkeit: Leicht löslich in Wasser
Dichte: 2,43 g/cm³
Aussehen: Weißes kristallines Pulver
Gefahrensymbol: Xn (Gesundheitsschädlich)
R-Sätze:
R22 (Gesundheitsschädlich beim Verschlucken)
R36/37/38 (Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut)
S-Sätze:
S26 (Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren)
S36 (Geeignete Schutzkleidung tragen)
S37/39 (Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen)
UN-Nummer: 3262
Physikalische und chemische Eigenschaften
Kaliumcarbonat liegt als weißes körniges oder kristallines Pulver vor. Die wichtigsten Eigenschaften sind:
Löslichkeit: Sehr gut wasserlöslich, bildet eine alkalische Lösung; unlöslich in Ethanol, Aceton und Ether. Besonders geeignet für wasserbasierte Anwendungen wie Fertigation und industrielle Lösungen.
Hygroskopizität: Starke Hygroskopizität, nimmt aus der Luft CO₂ und Feuchtigkeit auf und bildet dabei allmählich Kaliumhydrogencarbonat. Erfordert luftdichte Verpackung bei Lagerung und Transport.
Hydrate: Kommt als Monohydrat, Dihydrat und Trihydrat vor; verliert Kristallwasser bei 100 °C und weist gute thermische Stabilität auf.
pH-Wert: Eine 10%ige Lösung hat einen pH-Wert von ca. 11,6 – wirksam als Bodenverbesserer sowie als Neutralisationsmittel in Lebensmittel- und Industrieprozessen.
Herstellungsverfahren
Kaliumcarbonat kann auf verschiedene Arten hergestellt werden:
Pflanzenasche-Verfahren (historisch, geringe Reinheit, heute weitgehend aufgegeben außer in abgelegenen Regionen oder Handwerk).
LeBlanc-Verfahren (industrielles Verfahren des 18. Jahrhunderts, energieintensiv, inzwischen obsolet).
Elektrolyseverfahren (heute gängig, großtechnisch):
KCl wird elektrolysiert zu KOH-Lösung, diese mit CO₂ karbonisiert → Kaliumhydrogencarbonat → durch Kalzinieren zu K₂CO₃.
Vorteile: Günstige Rohstoffe, hohe Ausbeute, keine „drei Abfälle“, skalierbar.
Nachteil: Hoher Stromverbrauch.
Ionenaustauschverfahren (flexibel, kleinmaßstäblich, hohe Reinheit):
Verwendet Kationenaustauscherharz und Ammoniumhydrogencarbonat; Lösung wird verdampft, kristallisiert und kalziniert.
Vorteile: Sehr hohe Produktqualität, geringer Energieverbrauch.
Nachteil: Hohe Harzersatzkosten, geringere Kapazität.
Vergleich der Hauptverfahren:
Dimension | Elektrolyseverfahren | Ionenaustauschverfahren |
Rohstoffe | KCl, Strom, CO₂ | KCl, Ammoniumhydrogencarbonat, Harz |
Reinheit (industriell) | 99–99,5 % | 99,5–99,8 % |
K-Umwandlungsrate | ≥95 % | ≥92 % |
Energieverbrauch (tce/t) | ~1,2 | ~0,6 |
Jahreskapazität/Linie | 100.000–300.000 t | 5.000–20.000 t |
Investition | Hoch (~150 Mio. RMB/100k t) | Niedrig (~20 Mio. RMB/10k t) |
Umweltaspekte | Keine „drei Abfälle“, Cl₂ rückgewinnbar | Ammoniumhaltiges Abwasser |
Geeignet für | Großmaßstäbe, stromreiche Regionen | Kleinmaßstäbe, höchste Reinheit |
Anwendungsbereiche
🌱 LandwirtschaftProblem: Bodenversauerung durch dominierende saure Dünger (Harnstoff, MAP, MKP, Ammoniumsulfat etc.) bei gleichzeitig geringem Angebot an alkalischen Düngern.
Vorteile von Kaliumcarbonat:
Hohe Reinheit für wasserlösliche Dünger – 100 % K⁺, keine Chlorid- oder Sulfatverunreinigungen, vermeidet Versalzung, verbessert Nährstoffaufnahme.
Bodenregulierung – Neutralisiert Übersäuerung, stellt Bodenstruktur wieder her, hält pH bei 6,0–7,5.
CO₂-Freisetzung – Unterstützt Photosynthese im Gewächshaus, senkt Arbeits- und Zusatzkosten.
Praktische Anwendungen:
Szenario | Bedingung | Methode | Dosierung |
Bodenverbesserung (sauer) | pH < 6,0 | Spritzen/Tröpfchenbew. | 30 kg/ha |
Basenliebende Kulturen | Orchideen, Nelken etc. | Spritzen/Tröpfchenbew. | 30 kg/ha |
🐄 TierernährungNährwert:
Liefert Kalium (Osmoregulation, Nervenleitung, Muskelarbeit).
Carbonat-Anion wirkt als Puffersystem im Säure-Basen-Haushalt.
Fütterungseffekte:
Beugt Kaliummangel (Schwäche, Wachstumsstörungen, Arrhythmien) vor.
Lindert Hitzestress durch Ersatz verlorener K⁺-Ionen.
Verbessert DCAD in Milchkuhrationen, verhindert Azidose.
Dosierung:
Im Alleinfutter: 0,1–0,3 %
Milchkuh: 100–150 g/Tag (Überdosierung vermeiden).
🍜 LebensmittelindustrieAls Säureregulator, Neutralisations- und Alkalimittel in Nudeln, Backwaren und Milchprodukten.
Im Vergleich zu Natriumcarbonat:
Knackigere Nudeln, bessere Textur.
Ersetzt Na⁺ durch K⁺ → förderlich für Herz-Kreislauf-Gesundheit.
Typische Dosierung: 0,1–2 % in Mehlprodukten.
⚙️ Weitere industrielle AnwendungenGlas: Erhöht Transparenz und Stabilität bei optischem Glas, Lampen, Bildröhren.
Elektronik/Galvanik: pH-Regulator, hochreines Reagenz.
Pharma/Farbstoffe: Zwischenprodukt, Hilfsstoff.
Weitere: CO₂-Absorber, Löschpulver, Gummi-Antioxidans, Gaswäsche bei Düngemitteln.
Weltmarktüberblick
Marktgröße:
2024 auf Rekordhoch, wächst trotz Rohstoff- und Logistikproblemen jährlich um 3–5 %.
Regionale Verteilung (2024):
Asien (55–60 %): Getrieben durch Landwirtschaft und Industrie in China & Indien.
Europa (20–25 %): Nachfrage nach hochreinen Qualitäten in Lebensmittel/Pharma, strenge Umweltauflagen.
Nordamerika (15–20 %): Ausgewogene Nachfrage, teilweise Importabhängigkeit.
Zukunft (2024–2032):
Asien: >65 % Marktanteil bis 2032, getrieben durch Modernisierung & Industrialisierung.
Europa/USA: Leichter Rückgang im Anteil wegen geringerer Wachstumsraten und Produktionsverlagerung.
Trend zur Hochreinheit: Nachfrage nach ≥99,5 % Reinheit wächst jährlich um 8–10 %, weit über den Standardqualitäten (2–3 %).
Fazit
Kaliumcarbonat ist ein multifunktionaler, sektorenübergreifender Schlüsselrohstoff mit Vorteilen wie Alkalität, hohem Kaliumgehalt und geringer Verunreinigung.
Produktion: Elektrolyse- und Ionenaustauschverfahren dominieren – großtechnisch vs. hochrein.
Anwendung: Von Bodenverbesserung über Tierernährung und Lebensmittelqualität bis zu Glas, Elektronik und Pharma.
Markt: Globales Wachstum, Asien als Treiber, Hochrein-Produkte als Wettbewerbsschwerpunkt.
Mit der weiteren Modernisierung der Landwirtschaft, Industrialisierung und wachsendem Gesundheitsbewusstsein wird Kaliumcarbonat seine Rolle als Grundpfeiler in zahlreichen Branchen weiter ausbauen.

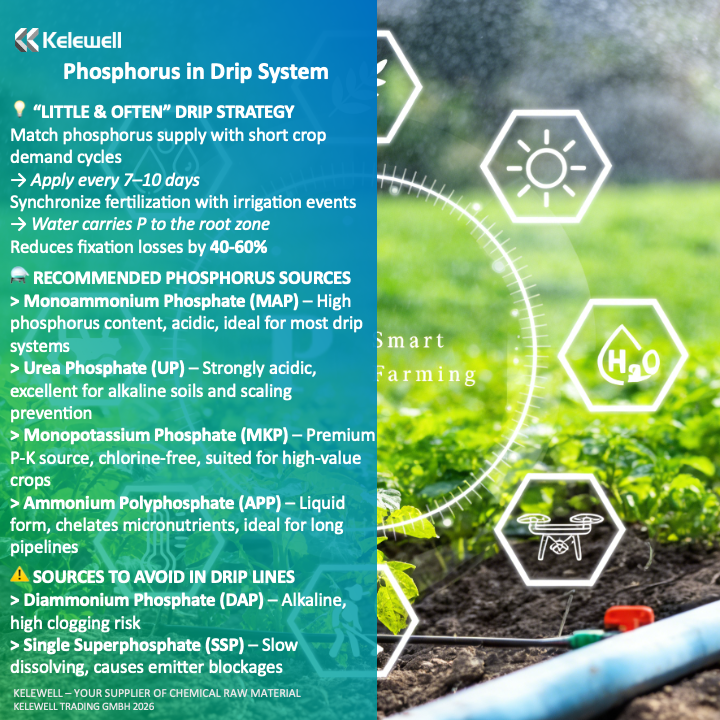


Kommentare