Vom Acker zur Weide: Harnstoffphosphat und Zinksulfat als Futtermittelzusatzstoffe für Nutz- und Geflügeltiere
- Camille W.

- 17. Sept. 2025
- 4 Min. Lesezeit
In der landwirtschaftlichen Produktion gelten Düngemittel in der Regel als entscheidende Betriebsmittel zur Förderung des Pflanzenwachstums. Weniger Beachtung findet jedoch die Tatsache, dass bestimmte Düngemittel aufgrund ihrer besonderen Nährstoffzusammensetzung und physikochemischen Eigenschaften auch bereichsübergreifend als Futtermittelzusatzstoffe für Nutz- und Geflügeltiere eingesetzt werden können – zur Förderung der Tiergesundheit und zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in der Tierhaltung. Unter ihnen sind Harnstoffphosphat und Zinksulfat zwei besonders repräsentative Beispiele. Ersteres stellt als Stickstoff-Phosphor-Verbunddünger eine effiziente Nährstoffergänzung speziell für Wiederkäuer dar; letzteres deckt als Spurenelementdünger den Zinkbedarf aller Nutztierarten. Obwohl sie unterschiedlichen Düngemittelkategorien angehören, zeigen beide im Futtereinsatz einen hohen Wert – vorausgesetzt, sie werden gemäß wissenschaftlichen Standards verwendet, um Sicherheit und Wirksamkeit zu gewährleisten.
I. Harnstoffphosphat: Vom N–P-Dünger zum Spezialzusatzstoff für Wiederkäuer
Harnstoffphosphat (chemische Formel: CO(NH₂)₂·H₃PO₄) ist in der Landwirtschaft ein hochwirksamer Stickstoff-Phosphor-Verbunddünger, der Kulturpflanzen gleichzeitig mit Stickstoff und Phosphor versorgt. Im Tierfutter hat es sich aufgrund seiner Vorteile der „doppelten N–P-Versorgung + sicheren Langsamfreisetzung“ zu einem speziellen Nährstoffzusatzstoff für Wiederkäuer (z. B. Rinder, Schafe, Hirsche) entwickelt. Damit wird das verbreitete Problem eines unausgeglichenen Stickstoff-Phosphor-Angebots in herkömmlichem Futter gelöst, das häufig zu Stoffwechselstörungen führt.
1. Fütterungslogik: Anpassung an die Physiologie der Wiederkäuer
Im Pansen von Wiederkäuern existiert eine große Mikrobenpopulation. Diese Mikroorganismen können Nicht-Protein-Stickstoff in mikrobielle Proteine umwandeln, die vom Tier aufgenommen werden. Dies bildet die Grundlage für den Einsatz von Harnstoffphosphat im Futter:
Langsam freisetzende Stickstoffquelle, geringeres Risiko: Die Harnstoffkomponente setzt Ammonium-Stickstoff verzögert frei. Dies versorgt die Mikroben mit Substrat zur Proteinsynthese und vermeidet gleichzeitig Pansen-Ammoniakvergiftungen, wie sie durch die schnelle Freisetzung von gewöhnlichem Harnstoff auftreten. Studien zeigen: Innerhalb einer Stunde werden im simulierten Pansen bei normalem Harnstoff 60–70 % des Gesamtstickstoffs freigesetzt, bei Harnstoffphosphat nur 20–30 %.
Direkte Phosphorversorgung: Das Phosphat im Molekül kann direkt aufgenommen werden, unterstützt Knochenaufbau, Energiestoffwechsel (z. B. ATP-Synthese) und Zellmembranbildung. Besonders vorteilhaft für Jungtiere (z. B. Lämmer im Alter von 3–6 Monaten) und laktierende Muttertiere, deren Phosphoraufnahme häufig unzureichend ist.
Pansenregulation, verbesserte Verdauung: Harnstoffphosphat kann den Pansen-pH leicht auf 6,5–7,0 einstellen – optimal für mikrobielle Aktivität. Dadurch vermehren sich Cellulose abbauende Bakterien, was die Verdaulichkeit von Raufutter um 10–15 % steigert.
2. Anwendungsszenarien und Effekte
Mast von Rindern/Schafen: Zugabe von 1–2 % Harnstoffphosphat im Futter ersetzt 5–10 % Eiweißfutter (z. B. Sojaschrot) und senkt Kosten. Lämmer mit 1 % Ersatz erreichten die höchsten täglichen Zunahmen; Masttiere gewannen 15–20 % schneller, Mastperioden verkürzten sich um 7–10 Tage.
Milchkühe/-ziegen: 0,8–1,2 % bei Kühen bzw. 0,5–1 % bei Ziegen reduzieren Phosphorverluste, erhöhen Milchleistung um 5–12 % und steigern den Milchfettgehalt um 0,2–0,3 %.
Weidetiere: In Winterfutterknappheit verhindert 1–1,5 % Harnstoffphosphat im Kraftfutter Gewichtsverlust (0,5–1 kg weniger pro Monat) und senkt die Häufigkeit von Mangelerkrankungen (z. B. Rachitis).
3. Anwendungsstandards
Qualität: Nur Futtermittelqualität (Reinheit ≥98 %) verwenden. Düngemittelqualität kann Schwermetalle oder Fluoride enthalten.
Dosierung: Normal 1–3 % der Trockenmasse, für Jung-/Tragtiere 0,5–1 %. Überdosierung kann Blähungen verursachen.
Kombination: Nicht mit rohen Sojabohnen oder frischen Leguminosen gleichzeitig in großen Mengen einsetzen (hohe Ureaseaktivität → schnelle Ammoniakfreisetzung). Mischung mit Mais, Kleie oder Stroh empfohlen.
II. Zinksulfat: Vom Spurenelementdünger zum universellen „Zink-Supplement“ für Nutz- und Geflügeltiere
Zinksulfat (ZnSO₄) ist ein gängiger Spurenelementdünger zur Korrektur von Zinkmangelböden und zur Vorbeugung von Pflanzenkrankheiten. Im Futter wird es aufgrund seiner hohen Löslichkeit und Bioverfügbarkeit (>80 %) breit als Zinkquelle für Schweine, Geflügel, Wiederkäuer und Aquakultur eingesetzt. Es beugt Wachstumsverzögerungen und Immunschwäche durch Zinkmangel vor.
1. Fütterungslogik: Versorgung mit essenziellem Spurenelement
Wachstumsförderung, Anti-Deformitäten: Bei Jungtieren (z. B. Ferkeln, Küken) unterstützt Zink die Proteinsynthese und Zellteilung. Wachstumsgeschwindigkeit steigt um 15–20 %.
Haut- und Darmgesundheit: Zink ist entscheidend für die Keratinisierung. Es beugt Dermatitis vor und senkt die Durchfallrate nach dem Absetzen von Ferkeln um 20–30 %.
Immunität und Reproduktion: Zink aktiviert Immunzellen, senkt Infektionsraten um 15–20 %, verbessert Spermienqualität bei Ebern (+10–15 %) und steigert Legeleistung sowie Schlupfraten (+3–8 %).
2. Artspezifische Anwendung
Schweine: 80–120 mg/kg bei abgesetzten Ferkeln; 60–80 mg/kg bei Mastschweinen. Senkt Durchfall und verbessert Futterverwertung.
Geflügel: 60–80 mg/kg bei Broilern; 70–90 mg/kg bei Legehennen. Verringert Schalenbrüche, verlängert Legepeak.
Wiederkäuer: 40–60 mg/kg bei Masttieren; 50–70 mg/kg bei tragenden Muttertieren. Reduziert Klauenerkrankungen und Aborte.
Aquakultur: 30–50 mg/kg bei Fischen/Garnelen. Fördert Schuppen-/Panzentwicklung und Stressresistenz.
3. Anwendungsstandards
Reinheit: Futtermittelqualität: mind. 35 % Zn (Monohydrat) bzw. 28 % Zn (Heptahydrat); strenge Grenzwerte für Schwermetalle und Arsen.
Mischverfahren: Vorvermischung mit Trägern (z. B. Kleie, Kalksteinmehl) notwendig für gleichmäßige Verteilung.
Kombination: Kann mit anderen Spurenelementen kombiniert werden, nicht mit hochkalziumhaltigen Futtermitteln (Bildung unlöslicher Zinksalze, geringere Aufnahme).
III. Gemeinsame Prinzipien für den Übergang von Dünger zu Futtermittel
Ob Harnstoffphosphat oder Zinksulfat – sicherer und wirksamer Einsatz als Futtermittelzusatz erfordert die Einhaltung gemeinsamer Grundsätze:
Futtermittel- vs. Düngemittelqualität unterscheiden: Nur geprüfte Futtermittelqualität einsetzen.
Exakte Dosierung: Wirkung ist dosisabhängig; Mangel wie Übermaß schaden.
Homogene Mischung: Vorvermischung und geeignete Technik vermeiden lokale Überdosierungen.
Anpassung an physiologische Phasen: Jungtiere, tragende und laktierende Tiere benötigen angepasste Dosierungen.
Fazit
Der bereichsübergreifende Einsatz von Harnstoffphosphat und Zinksulfat – vom Dünger zum Futtermittelzusatz – bricht mit der traditionellen Sichtweise, dass Dünger nur Pflanzen dienen. Ihr erfolgreicher Einsatz in der Tierernährung zeigt effizientes Ressourcenrecycling und eine integrierte landwirtschaftliche Entwicklung. Ihr Nutzen hängt jedoch von der Wahl der richtigen Qualität, der präzisen Dosierung und einer wissenschaftlich fundierten Anwendung ab. Nur so können diese Stoffe ihr volles Potenzial in der Tierhaltung entfalten – mit dem Ergebnis von Kostensenkung, Effizienzsteigerung, Sicherheit und Qualitätsverbesserung. Ihre „Crossover-Reise“ verdeutlicht moderne Konzepte effizienter Ressourcennutzung und die Synergie zwischen Pflanzenbau und Tierhaltung.

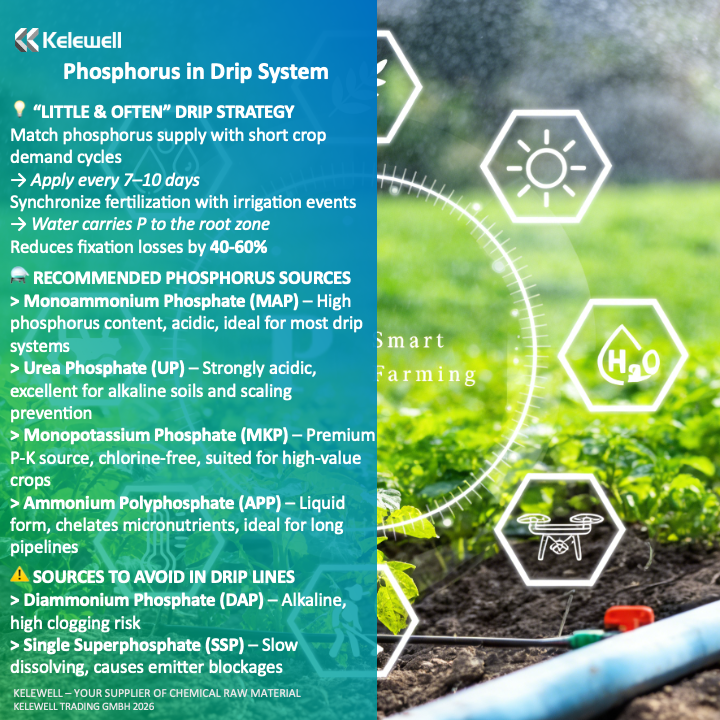


Kommentare